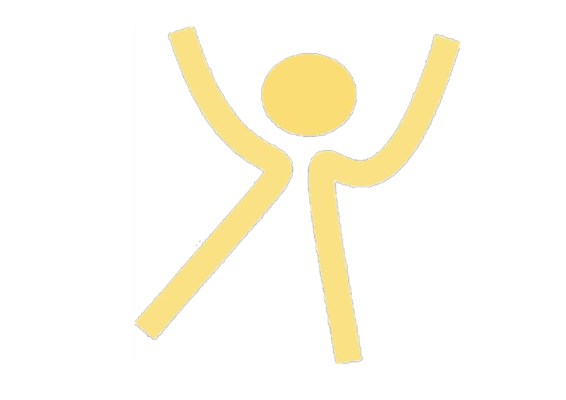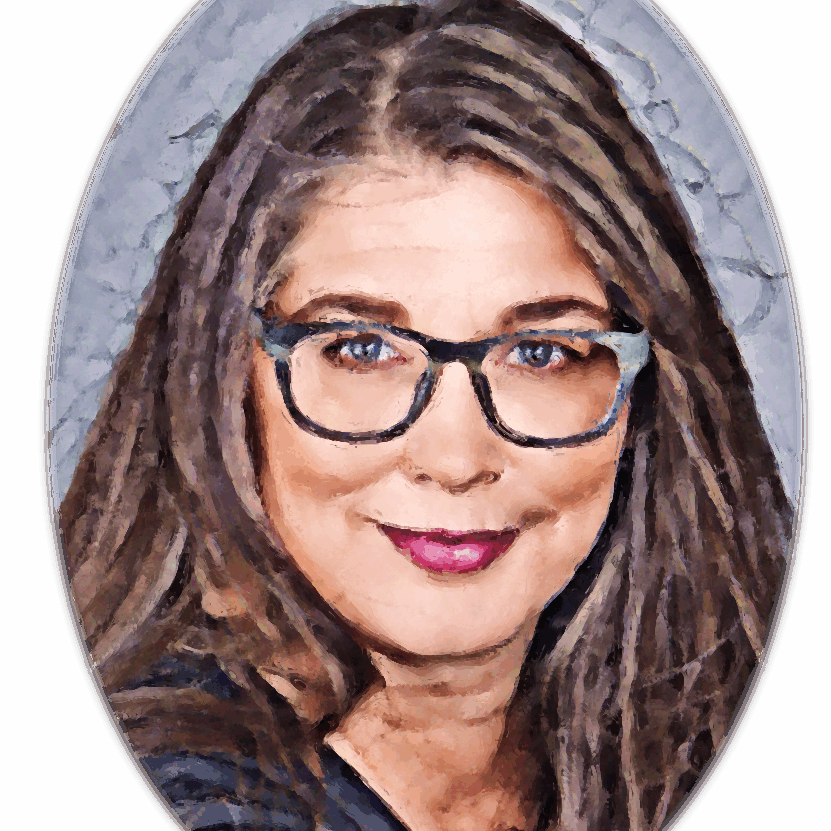In der lerntherapeutischen Praxis begegnen mir Kinder und Jugendliche mit sehr individuellen Herausforderungen – und gleichzeitig sind sie nie losgelöst, von ihrem Umfeld zu betrachten. Es wird deutlich: Lerntherapie bedeutet mehr, als nur mit dem Kind an seinen schulischen Schwierigkeiten zu arbeiten. Ebenso deutlich ist: Systemisches Arbeiten bedeutet mehr, als lediglich die Eltern oder die Schule einzubeziehen, also das System des Kindes.
In diesem Beitrag zeige ich auf, wie systemische Methoden die Lerntherapie bereichern – durch eine professionelle Haltung, durch gezielten Perspektivwechsel und durch konkrete Werkzeuge im Alltag. Der Nutzen für die Kinder? Sie werden selbstbestimmter und erhalten einen anderen Blick auf sich selbst.
1. Was bedeutet „systemisch“ in der Lerntherapie?
Systemisches Arbeiten basiert auf einem Grundverständnis, dass unser Verhalten immer im Zusammenhang mit unseren Erfahrungen, unseren Erwartungen und auch mit anderen Menschen steht. Das Kind hat nicht das „Problem“ in sich, sondern es sind die Zusammenhänge die verstanden werden müssen. Eine Legasthenie mit einer wohlwollenden und wertschätzenden Umwelt, zeigt sich anders als eine Legasthenie in einer Umwelt, in der es in erster Linie um Leistung geht und nur wenig bis gar kein Verständnis vorhanden ist, mit welchen Herausforderungen das Kind zu tun hat.
In der Lerntherapie bedeutet das: Wir sehen das Kind in seiner Ganzheit immer in Bezug zu seiner Umwelt. Es lebt eingebettet in ein Netzwerk von Beziehungen, Einflüssen und inneren Überzeugungen. Lernstörungen oder schulische Blockaden werden in ihrer Funktion, Geschichte und Wechselwirkung mit der Umgebung betrachtet.
Systemisches Arbeiten setzt auf Ressourcenorientierung, auf Kooperation und auf die Stärkung von Selbstwirksamkeit.
2. Das System des Kindes – mehr als Elternhaus und Schule
Manchmal wird systemisches Arbeiten in der Lerntherapie darauf reduziert, dass Eltern regelmäßig eingebunden oder Lehrkräfte informiert werden. Das ist wichtig – aber greift aus meiner Sicht zu kurz. Systemisch arbeiten heißt, insbesondere die inneren Systeme des Kindes zu erkennen: seine Selbstbilder, seine Überzeugungen, seine bisherigen Erfahrungen mit Lernen, Scheitern und Rückmeldung.
Ebenso gehören dazu die unausgesprochenen Botschaften, die das Kind aus seiner Umgebung verinnerlicht hat – etwa: „Ich bin langsam“, „Mathe kann ich nicht“, oder auch: „Wenn ich versage, wird jemand enttäuscht sein.“ Diese inneren Glaubenssätze wirken wie ein System, das Einfluss auf Motivation und Verhalten nimmt.
Systemisch arbeiten heißt also: Die Beziehungsmuster im Außen UND im Inneren des Kindes wahrzunehmen – und diese behutsam zu verändern – immer mit einer kooperativen Zusammenarbeit mit dem Kind. Diese kooperative Zusammenarbeit sehe ich als notwendig an.
3. Systemische Methoden im lerntherapeutischen Setting
Systemische Methoden können die Arbeit in der Lerntherapie spürbar bereichern. Sie sind oft niedrigschwellig, kreativ einsetzbar und fördern die aktive Beteiligung des Kindes. Hier einige Möglichkeiten:
- Zirkuläres Fragen – neue Sichtweisen durch hypothetische, dritte Perspektiven.
- Genogramm oder Soziogramm – kindgerecht mit Symbolen oder Bildern Beziehungsgeflechte darstellen.
- Reframing – Schwierigkeiten umdeuten und damit entlasten.
- Skalierung – Entwicklung und Fortschritt sichtbar machen.
- Symbolische Aufstellungen – mit Figuren oder Bodenankern Situationen nachstellen und bearbeiten.
4. Die innere Haltung
Systemisches Arbeiten beginnt nicht mit einer Methode – sondern mit einer inneren Haltung:
- Ich bin nicht die „Reparaturinstanz“, sondern eine Begleitung.
- Ich frage mehr, als ich erkläre.
- Ich sehe Verhalten als Lösung, nicht als Störung.
- Ich arbeite mit dem, was ist – und nicht gegen das, was fehlt.
Auch die eigene Reflexion gehört zur systemischen Arbeit:
- Wo stehe ich im Beziehungssystem?
- Welche Erwartungen habe ich selbst?
- Welche Rollen übernehme ich vielleicht unbewusst?
Supervision, kollegiale Fallbesprechungen und regelmäßige Selbstreflexion helfen, sich nicht in Mustern zu verfangen und den Blick auf das Ganze zu behalten. Gerade die eigenen Erwartungen sind wichtig. Ein Beispiel: In einigen Stunden bemerkte ich eine Unruhe, die ich zuerst nicht erklären konnte. Mir war der Fortschritt zu langsam, wir waren „immer noch“ an diesem einen Punkt. Nachdem mir dies deutlich wurde, bin ich zwei Schritte zurückgegangen und so konnte das Kind wieder in seinem Tempo lernen und es machte den erhofften Fortschritt. Mein eigener Druck erhöhte unbewusst auch den Druck auf das Kind.
5. Der Nutzen systemischer Methoden für die Lerntherapie
Systemisches Denken und Handeln in der Lerntherapie schafft Räume:
- für Selbstwirksamkeit: Das Kind erlebt, dass es aktiv Einfluss nehmen kann.
- für Beziehungsqualität: Der Dialog wird partnerschaftlich, nicht defizitorientiert.
- für Nachhaltigkeit: Veränderungen entstehen nicht nur durch Übungen, sondern durch neue Erfahrungen im Miteinander.
- für Fachkräfte: Die systemische Perspektive schützt vor Überforderung – weil sie nicht alles alleine „lösen“ muss, sondern Zusammenhänge sichtbar macht.
Fazit
Systemisches Arbeiten in der Lerntherapie schafft Räume für Entwicklung – durch eine klare Haltung, einen weiten Blick auf Zusammenhänge und durch Methoden, die Beteiligung und Veränderung ermöglichen.
Es stärkt Kinder und Jugendliche in ihrer Selbstwahrnehmung und Eigenverantwortung und unterstützt Fachkräfte dabei, Lernprozesse differenziert, wirksam und mit Leichtigkeit zu begleiten.
Wenn du deine eigene Praxis reflektieren und systemische Impulse gezielt vertiefen möchtest, bist du herzlich eingeladen zur Supervision für Lerntherapeut:innen.